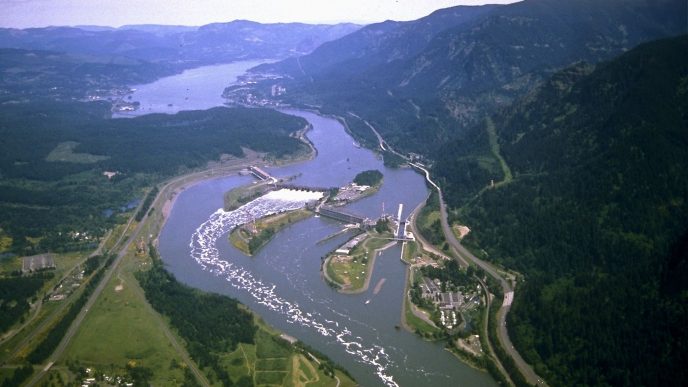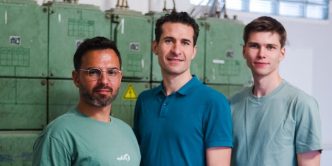Das Netzwerk für Quartierslösungen und Sektorkopplung sieht nach einer anwaltlichen Prüfung in dem viel diskutierten Gerichtsbeschluss auch „zielführende Ansätze“. Erforderlich sind nach seiner Auffassung aber Klarstellungen durch Gesetzgeber und Bundesnetzagentur.
Der Open District Hub (ODH), ein Netzwerk aus rund 50 Unternehmen und Organisationen für Quartierslösungen und Sektorkopplung, sieht im Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Sachen „Kundenlage“ deutlich mehr positive Aspekte als andere Akteure. Das ODH-Mitglied HFK Rechtsanwälte hat eine aktualisierte Einschätzung erstellt, nachdem seit Anfang Juli die Begründung für den am 13. Mai verkündeten Beschluss des BGH vorliegt.
Stefan Söchtig von HFK Rechtsanwälte erklärt, der BGH habe zu seinem Urteil ein Obiter Dictum hinzugefügt, also eine über den eigentlichen Streitgegenstand hinausgehende Rechtsansicht dargelegt. Das sehen etliche Akteure im Bereich Mieterstrom und Quartierskonzepte ähnlich, fürchten aber genau deshalb aus dem Urteil – bei dem es eigentlich um die Versorgung einer Wohnanlage mit Strom aus einem Blockheizkraftwerk ging – erhebliche negative Konsequenzen für Photovoltaik-Mieterstrom, gemeinschaftliche Gebäudeversorgung und ähnliche Konzepte.
Der ODH sieht im Obiter Dictum indes „Hinweise für den Gesetzgeber und die Regulierungsbehörden“, die aber nicht so zu verstehen seien, dass der im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in Paragraf 3 Nr. 24a definierte Begriff der Kundenanlage nun vollkommen hinfällig sei. Der von einigen Akteuren geäußerten Auffassung, mit dem BGH-Urteil würden de jure sogar unabhängig von Mieterstrom-Konzepten sämtliche zwischen Netzanschlusspunkt und Stromzählern liegenden Elektroinstallationen von Mehrparteienhäusern zum Bestandteil des Verteilnetzes, widerspricht Söchtig. Hausanlagen nach Paragraph 13 Absatz 1 Satz 1 Netzanschlussverordnung (der die Verantwortung des Gebäudeeigentümers für die elektrischen Anlagen hinter der Hausanschlusssicherung definiert) seien „zumindest in Gebäuden und dazugehörigen Nebenanlagen“ nicht betroffen – nicht vom Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), der vom BGH in dem betreffenden Verfahren angerufen wurde, aber in der Folge auch nicht durch das anschließende BGH-Urteil und dessen Begründung.
Generell sehen Söchtig und der ODH in der Urteilsbegründung eine Klarstellung dafür, „dass es um ein Netz ging, dass anstelle des bisherigen Verteilnetzes errichtet wird, um darüber Strom zu verkaufen“. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Nutzung bereits vorhandener Netze nicht betroffen ist und – relevant nicht für Mieterstrom, aber für klassische Eigenverbrauchsmodelle – auch nicht die Verwendung neu installierter Netze, wenn sie nicht zum Verkauf genutzt werden.
Nichtsdestotrotz bleibe jedoch „das Erfordernis einer Klarstellung durch den Gesetzgeber und in der Übergangszeit durch die Bundesnetzagentur bestehen“. Grundsätzlich bleibe aber „bei differenzierter Betrachtung des Urteils mit dem Obiter Dictum“ nach Ansicht von HFK Rechtsanwälte „weiter einiges im Bereich Kundenanlagen möglich“. Der Begriff sei nicht grundsätzlich infrage gestellt worden. So habe der BGH in seiner Begründung auf ein bereits 2009 von der EU gegen die Bundesrepublik Deutschland geführtes Vertragsverletzungsverfahren verwiesen, bei dem die in Deutschland geltende „Ausnahme vom Begriff des Verteilernetzbetreibers“ nicht beanstandet wurde.
Der Gesetzgeber, so Söchtig, könne die vom BGH dargestellten Ansätze gesetzlich und in Übereinstimmung mit EU-Recht regeln. Damit könnten Kundenanlagen weiterhin nicht als Netze eingestuft werden. „Falls dies nicht möglich ist oder für Grenzfälle, sollten Ausnahmen mit der EU abgestimmt werden. Diese Ausnahmen könnten dann von der EU-Kommission in einem einfachen Prozess nach festen Kriterien, die im Idealfall den bisherigen entsprechen, genehmigt werden.“
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.