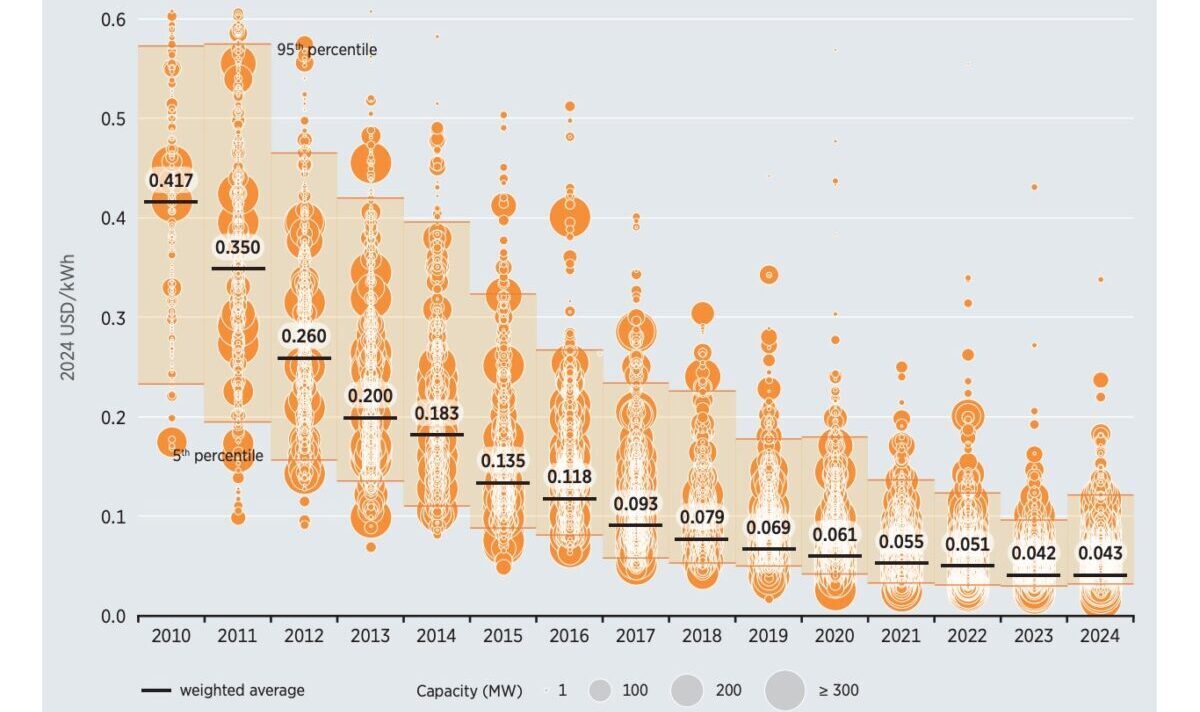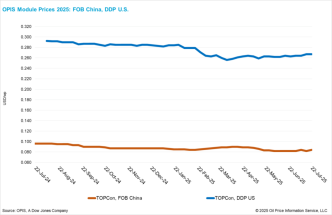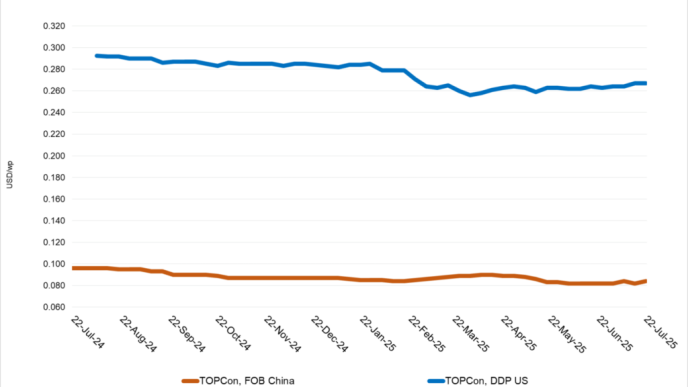Messstation auf dem Dach eines HZB-Forschungsgebäudes: Dort werden Solarzellen unter realen Wetterbedingungen untersucht.
HZB/ Industriefotografie Steinbach
Perowskit-Solarzellen haben mittlerweile auch über mehrere Jahre recht stabile Wirkungsgrade, die in den Wintermonaten jedoch deutlich zurückgehen – das ergaben zumindest die am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) durchgeführten Langzeitmessungen an kleinen, in Glas verkapselten Perowskit-Zellen. Ein Forschungsteam um Carolin Ulbrich und Mark Khenkin hat die Daten aus mittlerweile vier Jahre währenden Freilicht-Messungen ausgewertet und damit die nach Angaben des Instituts bislang längsten Messreihe zu Perowskit-Zellen im Außeneinsatz vorgelegt.
Die Resultate, heißt es in einer Mitteilung, seien auch deshalb bedeutsam, weil Perowskit-Solarzellen im Labormaßstab mittlerweile Wirkungsgrade von bis zu 26,95 erreichen (gemeint sind hierbei nicht Perowskit-Tandemzellen, die noch deutlich höhere Werte erreichen), einfach herzustellen und preisgünstig seien – und weil erste Solarzellen auf Perowskit-Basis bereits auf dem Markt sind (auch dies betrifft insbesondere Module mit Tandemzellen). Es sei deshalb umso wichtiger „das langfristige Verhalten solcher Perowskit-Solarzellen im Außeneinsatz zu verstehen, damit sich Energieerträge und Lebensdauern noch besser vorhersagen lassen.“
Die Teststation am HZB wurde im Rahmen des Projekts TAPAS in Kooperation mit der Universität Ljubljana eingerichtet. Die dort neben weiteren Solarzellen unterschiedlicher Technologien seit vier Jahren platzierten kleinen Perowskit-Zellen wurden am HZB im Team von Eva Unger hergestellt. „Ermutigend“ nennt das Institut die Ergebnisse der Messungen: „In den ersten beiden Sommern blieb die Spitzenleistung nahezu gleich, zwischen dem ersten und vierten Sommer ging die Effizienz absolut nur um etwa 2 Prozent zurück.“
In den Wintermonaten allerding sank die Effizienz um circa 30 Prozent. Hierfür nennt das Team mehrere Ursachen. Zum einen ist in höheren Breitengraden wie in Berlin die Spektralverteilung des Sonnenlichts eine andere als in Äquatornähe. Es gibt mehr „blaue“ Anteile im Sommer und mehr „rote“ im Winter. Weil Perowskit-Solarzellen vor allem die blauen Anteile des Lichts in elektrische Energie umwandeln und die Spektralverschiebungen am Äquator geringer ausgeprägt sind, könnten sie dort „vermutlich im Jahresverlauf einen konstanteren Ertrag bringen“. Zum anderen sei auch der Tagesverlauf ein Faktor, erklärt Mark Khenkin, der als Doktorand die Daten auswertete: „Was Perowskit-Solarzellen von ausgereifteren Photovoltaik-Technologien unterscheidet, ist, dass sie ihren Wirkungsgrad im Tages-Nacht-Zyklus oft reversibel verändern; diese Eigenschaft trägt wesentlich zu den beobachteten starken saisonalen Schwankungen bei.“
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.