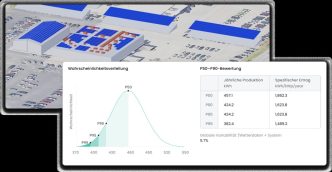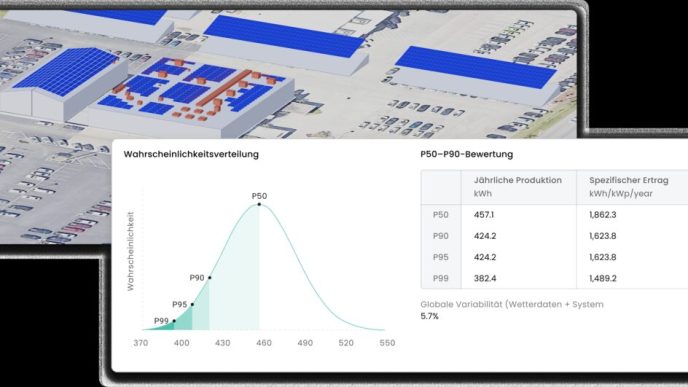Beim „Battery Business and Development Forum“ in Frankfurt am Main diskutierte die europäische Batteriebranche zum Ausbau von Netzspeichern. In einer Session zu Deutschland kamen Netzbetreiber und Batterieprojektierer zusammen. Der zügige Ausbau von Speichern gelinge nur im ehrlichen Dialog mit den Netzbetreibern, so einer der Projektierer.
Flexible Anschlussvereinbarungen sind Teil des Prozesses und müssen von Projektentwicklern nicht als lästig empfunden werden. So lässt sich eine der Kernaussagen der Session mit besonderem Bezug auf Deutschland beim „Battery Business & Development Forum (BBDF) 2025“ in Frankfurt am Main zusammenfassen. Das Event wurde gemeinsam von pv magazine, Solarpower Europe und Conexio-PSE organisiert. Rund 450 Teilnehmer aus der Solar- und Batterieentwicklungsbranche hatten sich eingefunden.
Während viele Projekte in Deutschland aufgrund von Netzengpässen mit jahrelangen Verzögerungen zu kämpfen haben und einige Netzbetreiber Anschlusssuchende über Wartezeiten bis 2029 informierten, eröffnet sich mit flexiblen Netzanschlussvereinbarungen ein neuer Weg für Entwickler. Eine Gesetzesänderung machte dafür den Weg frei. Erste Netzbetreiber probieren sich an der neuen Praxis. Im Kern geht es darum, einem Batteriespeicher zügiger einen Netzanschluss gewähren zu können, wenn der Netzbetreiber einige Restriktionen für die Art der Nutzung des Netzanschlusspunktes auferlegen darf. Dazu gehören unter anderem zeitliche Einschränkungen, von 10 bis 13 Uhr im Juli darf nicht eingespeist werden, zum Beispiel, oder die Definition von Anfahrtsrampen. Dabei handelt es sich um ein festgelegtes Intervall, in dem der Speicher seine volle Leistung anfahren darf. Die genaue Ausgestaltung der Vereinbarung hat jedoch auch einen großen Effekt auf die Erlöse eines Speicherprojekts.
Projekte mit maßgeschneiderter Flexibilität modellieren
Christina Hepp von Green Flexibility stellte das Konzept „Regiolink“ vor, welches das Unternehmen bereits in ersten Projekten umsetzt, etwa bei einem Batteriespeicher mit 15 Megawatt Leistung und 33 Megawattstunden Kapazität. Das Besondere dabei ist ein virtuelles Netzmodellierungstool, das intern entwickelt wurde, um die Aushandlung flexibler Anschlussvereinbarungen zu unterstützen. „Bevor wir eine Anlage bauen, simulieren wir, wie sie sich im Netz unter verschiedenen lokalen Einschränkungen, Redispatch-Anforderungen und Wettervorhersagen verhalten würde“, erklärte sie.
So kann Green Flexibility dem Verteilnetzbetreiber, in diesem Fall Allgäu Netz, zeigen, wie sich der Fahrplan der Batterie so steuern lässt, dass lokale Engpässe nicht verschlimmert werden. Sogar eine Entlastung von Netzengpässen sei möglich. Außerdem lassen sich mit der Simulation auch die Einnahmenverluste unter verschiedenen Limitationen der flexiblen Netzanschlussvereinbarung modellieren. Damit können dann auch Banken von tragfähigen Geschäftsmodellen selbst bei begrenzten Exportkapazitäten überzeugt werden.
Das erste Projekt, bei dem das Tool und eine flexible Netzanschlussvereinbarung zum Einsatz kam, ging am 4. Juli ans Netz und umfasst eine API-Schnittstelle für den Netzbetreiber. Dieser könne hierdurch die notwendigen Begrenzungen der Nutzung des Netzanschlusses umsetzen. Bei diesem Projekt, so Hepp, stellt der Netzbetreiber bis sieben Uhr morgens am Vortag einen Begrenzungsplan zur Verfügung. Dies ermöglicht es Green Flexibility, seine Optionen auf den Märkten für Netzdienstleistungen oder Arbitrage noch zu berücksichtigen und so die Batterie trotzdem am Markt zu optimieren.
Georg Gallmetzer von Eco Stor warnte vor dem Fachpublikum vor dem, was er als „überkochte Erwartungen“ im Markt bezeichnete. Wenn die Erwartungen an Eigenkapitalverzinsung und Erlöse extrem hoch sind, ist es schwierig, mit dem Verteilnetzbetreiber einen Dialog über mögliche Einschränkungen zu führen. Er wies auf die großen Plagen hin, die derzeit die Batteriegeschäftsmodelle in Deutschland behindern: Baukostenzuschüssen, flexiblen Netzanschlussvereinbarungen, Genehmigungen.
„All diese Probleme fressen die Eigenkapitalverzinsung auf“, sagte Gallmetzer. „Aber Batterien sind von Haus aus netzfreundlich. Vielleicht nicht in jedem einzelnen Fall und Moment, aber insgesamt. Das muss sich auch in der Diskussion um Netzentgelte und Systemrelevanz widerspiegeln“, sagte er in Anspielung auf den aktuellen AgNes-Prozess, mit dem die Bundesnetzagentur die Netzentgelte für Batterien auf regulatorischer Ebene neu festlegen wird.
Marcus Fendt von The Mobility House hat die finanziellen Auswirkungen von technischen Beschränkungen für Batteriespeichersysteme quantifiziert. Laut seiner Modellierung können Anfahrtsrampenbeschränkungen die Einnahmen um 44 Prozent senken, während andere Beschränkungen wie Exportbeschränkungen, Lieferbeschränkungen, die 100-Stunden-Regel und Hüllkurvenbeschränkungen die Einnahmen um 20 bis 30 Prozent verringern können. „Diese Einschränkungen werden von den Netzbetreibern oft in Kombination angewendet“, so Fendt.
Co-Location-Projekte könnten das nächste große Ding werden, fügte er hinzu, vor allem wenn ältere Anlagen aus der EEG-Förderung fallen. „Wir sehen jetzt erst die erste Welle von Batterien“, sagte er. „Die zweite Welle wird aus Co-Location-Projekten für Anlagen mit auslaufender Förderung bestehen, und sie wird größer sein. Doch der richtige Speicher-Tsunami kommt dann mit der Nutzung von Elektroautos und dem bidirektionalen Laden.“
Zusammenarbeit lernen: Entwickler und Netzbetreiber
Die anschließende Podiumsdiskussion unterstrich die Notwendigkeit einer offenen Kommunikation und eines gegenseitigen Verständnisses. Markus Graebig vom Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz verwies auf 112 Gigawatt an Netzanschlussanfragen allein in seinem Netzgebiet. „Wir müssen nach dem Windhundprinzip vorgehen, so sieht es das Gesetz vor. Aber das ist nicht immer die beste Lösung.“
Barbara Plura vom Verteilnetzbetreiber LVN fügte hinzu: „Wir werden mit Anfragen überschwemmt, aber es gibt kein standardisiertes Verfahren, um sie zu bewerten und zu beantworten. Es braucht also Zeit.“
Entwickler und Netzbetreiber forderten eine Änderung der Denkweise. „Zu oft gehen die Entwickler direkt zu ihren Anwälten“, sagte Gallmetzer. „Aber man muss mit dem Verteilnetzbetreiber sprechen und seine Probleme verstehen. Das ist ein Teil des Erfolgs.“ Seinen Aufruf zu einer besseren Zusammenarbeit der unterschiedlichen Rollen am Markt würdigten die Zuhörer mit spontanem Beifall.
Weitere Berichterstattung vom „Battery Business and Development Forum 2025“ finden Sie auf unserer ESS News Webseite.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.