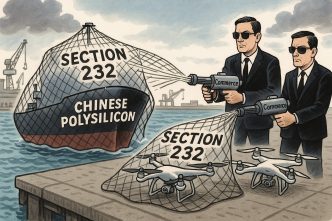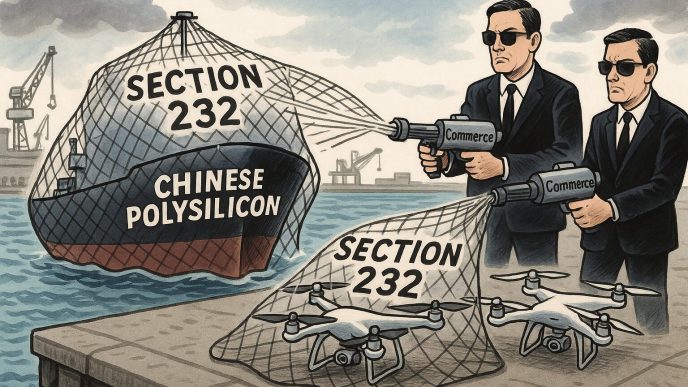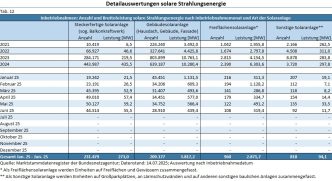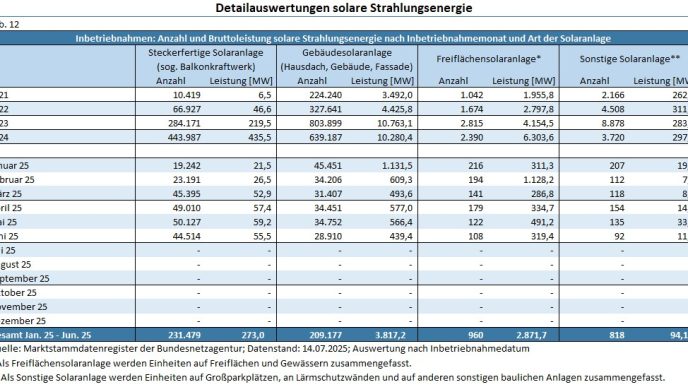Es ist ein Fall mit langer Vorgeschichte und, wie es scheint, auch erheblichen Nachwirkungen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 13. Mai postuliert: „Nur eine Energieanlage, die kein Verteilernetz ist, kann bei richtlinienkonformer Auslegung eine Kundenanlage sein.“ Warum dieser Satz – und seine genauere Darlegung im Beschluss – vor allem auf Photovoltaik-Mieterstromprojekte, aber auch auf gemeinschaftliche Gebäudeversorgung oder die Belieferung von Gewerbeunternehmen im Rahmen von sogenannten Onsite-PPA große Auswirkungen hat, erschließt sich Laien zunächst einmal nicht. Doch auch Fachleute streiten immer noch, selbst nachdem der BGH Anfang Juli die ausführliche Begründung veröffentlicht hat.
Dabei ging es in der rund siebenjährigen Vorgeschichte des BGH-Beschlusses ursprünglich gar nicht um Photovoltaik. Der französische Energiekonzern Engie versorgt seit Jahren schon zwei Wohnblöcke der Zwickau Wohnungsbaugenossenschaft, insgesamt 256 Wohneinheiten, über ein Nahwärmenetz mit Wärme und Warmwasser. 2018 begannen Planungen, diese Anlage auf Kraft-Wärme-Kopplung umzustellen und für die beiden Wohnblöcke zwei elektrische Leitungssysteme zu errichten, um die angeschlossenen Haushalte auch mit Strom zu beliefern; veranschlagt waren rund 770 Megawattstunden jährlich. Für diese beiden Installationen beantragte Engie den Anschluss an das Netz der Zwickauer Energieversorgung (ZEV) und die Bereitstellung von Zählerpunkten. Die ZEV hingegen war der Ansicht, es handele sich nicht um eine Kundenanlage im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG).
Der Energiekonzern legte die Angelegenheit daraufhin der Landesregulierungsbehörde beim sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vor, die aber im Juli 2019 der ZEV recht gab. Hiergegen klagte Engie, im September 2020 wies das Oberlandesgericht Dresden die Beschwerde jedoch zurück. Auch damit wollte Engie sich nicht abfinden und zog vor den Bundesgerichtshof. Der wiederum kam, kurzgefasst, zu dem Schluss, dass zwar das Urteil der Vorinstanz stellenweise fehlerhaft war, es gleichzeitig aber grundsätzliche Unklarheiten in Sachen Kundenanlage gebe.
Grundsätzliche Bedenken beim BGH
Dezentrale Anlagen, wie die in Zwickau geplante, so der BGH, könnten „einen Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem mit geringen CO2-Emissionen zwar erleichtern“, doch gleichzeitig gebe es auch ein Problem mit der Kostenverteilung. „Beim Anschluss einer Vielzahl vergleichbarer Kundenanlagen an das Verteilernetz“ müsse dessen Betrieb durch „zunehmend weniger Letztverbraucher“ finanziert werden, so die Richter. Für den in einer dezentralen Erzeugungsanlage erzeugten und in der daran angeschlossenen Kundenanlage verbraucht Strom seien schließlich keine Netzentgelte zu zahlen, „während der Verteilernetzbetreiber gleichwohl genug Netzkapazität vorhalten muss, um bei einem Ausfall der dezentralen Erzeugungsanlagen die Versorgung aufrecht zu erhalten“.
Als problematisch bewertete der BGH auch den Umstand, dass die Kosten für Errichtung, Betrieb und Wartung der Anlagen aufgrund des Wärmelieferungsvertrags von der Wohnungsbaugenossenschaft und damit von den Letztverbrauchern und Mietern beglichen werden. Dies führe „zu einer Wettbewerbsverzerrung im Verhältnis zwischen der Antragstellerin und anderen Stromlieferanten“. Engie habe bei dem Konzept schließlich „weder die Kosten für die Energieanlagen zur Abgabe von Energie zu tragen noch Netzentgelte zu zahlen“. Dies sei für eine einzelne Kundenanlage zwar nicht allzu bedeutsam, doch je mehr Anlagen vergleichbarer Art das Unternehmen betreibe, desto größer seien die zu erwartenden Auswirkungen auf den Wettbewerb. Dabei ist eines der im EnWG festgelegten Kriterien für Kundenanlagen, dass sie „für die Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas unbedeutend sind“.
Ebenfalls kritisch sah der BGH, dass Engie den Letztverbrauchern „sowohl als Eigentümerin und Betreiberin der Kundenanlage als auch als Stromlieferantin gegenübertritt“. Als Stromlieferantin habe sie „ein Interesse an der Durchsetzung möglichst hoher Strompreise“ und folglich wenig Interesse an einer transparenten Ausweisung „der von ihr erhobenen Entgelte für die Errichtung, den Betrieb und die Wartung der Anlagen“. So sei denn auch im Wärmelieferungsvertrag kein Nutzungsentgelt ausgewiesen. Damit hätten die Mieter auch keine Möglichkeit, „die insgesamt anfallenden Entgelte für den von ihnen bezogenen Strom zu ermitteln.“
In der Abwägung dieser und weiterer Punkte unterbrach der BGH das Verfahren und legte im Dezember 2022 dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage vor, ob der in Paragraf 3 Nr. 24a definierte Begriff der Kundenanlage womöglich der Elektrizitätsbinnenmarktrichtline der EU (Richtlinie 2019/44) entgegenstehe.
Solarbranche in banger Erwartung
Dass all dies womöglich etwas mit Mieterstrom zu tun haben könnte, drang erst im November 2024 ins Bewusstsein der Photovoltaik-Branche. Da nämlich verkündete die Fünfte Kammer des EuGH ihr Urteil, wohlgemerkt immer noch in Bezug auf den eigentlich eng umgrenzten Fall der Weigerung der ZEV, „zwei Energieanlagen von Engie als Kundenanlagen an ihr Netz anzuschließen und die erforderlichen Zählpunkte zur Verfügung zu stellen“. Doch es ging dabei unweigerlich auch um die ganz grundsätzliche Frage, ob der EnWG-Begriff der Kundenanlage der EU-Richtlinie zuwiderläuft, und die Antwort des EuGH lautete „Ja“.
Ab diesem Moment herrschte bange Erwartung, wie der BGH dies im weiteren Verfahren aufnehmen und in Bezug auf die deutsche Rechtslage bewerten werde. Fachleute warnten – auch in Beiträgen bei pv magazine – vor möglicherweise bedeutsamen Folgen. Und diese gab es dann auch. Mit seinem Beschluss vom 13. Mai wies der Kartellsenat des Karlsruher Gerichts die Beschwerde von Engie gegen das am Oberlandesgericht Dresden ergangene Urteil zurück.
Vor allem aber fasste er seine 17 Seiten umfassende Begründung in dem eingangs erwähnten Diktum zusammen, dass eine Kundenanlage nicht gleichzeitig ein Verteilernetz sein kann. Seine Brisanz für Mieterstrom- und ähnliche Modelle erlangt dieser Satz aus der Definition von „Verteilernetz“: Auf Grundlage der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie und des EuGH-Urteils definiert der BGH dies als „ein Netz, das der Weiterleitung von Elektrizität mit Hoch-, Mittel- oder Niederspannung dient, die zum Verkauf an Großhändler und Endkunden bestimmt ist“. An seiner eigenen, in früheren Entscheidungen vertretenen Auslegung, wonach es hierbei auch auf die Größe und Leistungsfähigkeit eines solchen Netzes ankomme, hält der BGH ausdrücklich nicht weiter fest. Wer aber ein Verteilernetz betreibt, ist unweigerlich Netzbetreiber mit allen daraus erwachsenden Pflichten, insbesondere hinsichtlich Netzsteuerung sowie Netzentgelten und deren Abrechnung.
Der Gesetzgeber ist gefragt
„Gänzlich praxisuntauglich“ findet dies Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar). Denn hierdurch, so seine Interpretation, würden auch „Millionen von Immobilienbesitzern zu Verteilnetzbetreibern, da der Strom durch die Hausverteilanlagen an die Endkunden weitergeleitet wird“. Eine derart harsche Auslegung findet sich in anderen Kommentaren zwar nicht, aber weitgehende Einigkeit besteht darin, dass der BGH-Beschluss nicht ohne Folgen für alle bleibt, die dezentrale Stromlieferkonzepte wie eben Mieterstrom oder Quartierslösungen verfolgen. Denn der EuGH und in der Folge der BGH definieren nur recht eng gefasste Ausnahmen, die von EU-Mitgliedsstaaten für „geschlossene Verteilernetze“ definiert werden können. Dies betrifft insbesondere Bürgerenergiegemeinschaften im Sinne der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie. Auch die reine Eigenversorgung, etwa von Wohnungseigentümergemeinschaften, dürfte als unkritisch gelten. Das gerade bei Mieterstromstromkonzepten gemäß EEG weit verbreitete Modell aber, bei dem ein externes Unternehmen die Stromlieferung an Wohn- oder Gewerbemieter übernimmt, gerät mit dem BGH-Beschluss in die Bredouille.
Der BSW-Solar geht indes „nicht davon aus, dass bisherige Konzepte wie Mieterstrom, On-Site PPA oder die gerade erst eingeführte Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ernsthaft in Gefahr sind“. Es sei aber der Gesetzgeber gefordert. Er müsse umgehend die einschlägigen Paragrafen der deutschen Gesetzgebung in Ordnung bringen, um „wieder Rechtssicherheit herzustellen, die entstandene Regelungslücke zu schließen und diesen neuen Bremsklotz der urbanen Energiewende schnell zu beseitigen“.
Auch Carolin Dähling, Bereichsleiterin bei Green Planet Energy, sieht Klärungsbedarf: „Die Rechtslage für Mieterstrom bleibt auch nach dem BGH-Urteil uneindeutig.“ Das Gericht stelle klar, dass bei Vorliegen eines Verteilernetzes nach der EU-Richtlinie „Mieterstromprojekte nicht mehr im Rahmen von Kundenanlagen umgesetzt werden können“. Wo aber die Grenze verlaufe, werde vom „nicht eindeutig aufgezeigt“.
Dählings Schlussfolgerung dürfte vermutlich die gesamte Branche unterstützen: Green Planet Energy fordert „die Bundesregierung und den Bundestag auf, jetzt eine neue, klare Regulatorik zu schaffen, die auch größere Mieterstrom- und Quartiersprojekte rechtssicher ermöglicht“. Die unmittelbar zuständige Bundesnetzagentur solle „praxisnahe Hinweise liefern, so dass kleine Mieterstromprojekte über Hausverteileranlagen weiterhin problemlos umgesetzt werden können. Nur mit verlässlichen Rahmenbedingungen schaffen wir Planungssicherheit und beschleunigen die urbane Energiewende.“
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.