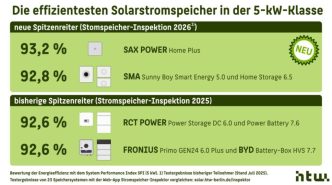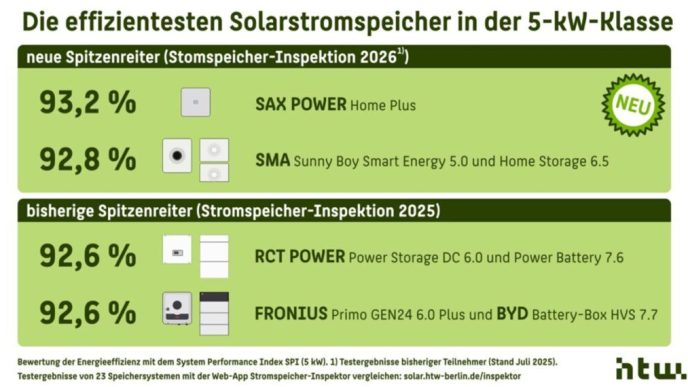Nach Ansicht der Stiftung muss der weitere Ausbau der Photovoltaik „kosteneffizient, sozial gerecht und netzdienlich“ erfolgen. Dafür sind dringend Maßnahmen erforderlich, wie unter anderem eine Deckelung der Einspeisevergütung. Allerdings sollte am eigentlichen Ausbauziel von 215 Gigawatt bis 2030 nicht gerüttelt werden.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat ihren „Realitätscheck für die Energiewende“ mehrfach angekündigt. Welche Ergebnisse er bringen wird, ist recht unklar. Doch ihre jüngsten Äußerungen, etwa auf einer BDI-Veranstaltung vor wenigen Tagen, lassen wenig Gutes für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren erahnen.
Die Stiftung Klimaneutralität hat einen eigenen Vorschlag in Form eines 10-Punkte-Plans entwickelt und „empfiehlt eine nachhaltige Neuausrichtung der Solarförderung“. So erfreulich der Photovoltaik-Ausbau der vergangenen Jahre gewesen sei, habe er doch auch Probleme geschaffen, die es dringend zu lösen gelte. „Der weitere Ausbau der Photovoltaik muss kosteneffizient, sozial gerecht und netzdienlich gesteuert werden“, fordert Rainer Baake, Direktor der Stiftung. Er war selbst früher Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Nun kritisiert er die Absichten von Reiche, die Ausbauziele für die Photovoltaik zu drosseln. „Nicht die Ausbauziele müssen gekürzt werden, sondern die Kosten“, sagt Baake. Photovoltaik sei mittlerweile die günstigste Form der Stromerzeugung und verdränge mit jeder erzeugten Kilowattstunde fossilen Strom, senke die Importabhängigkeit und vermeide CO2.
„Die gesetzlich festgelegten Ausbauziele bleiben deshalb richtig. Sie können aber zu geringeren Kosten erreicht werden“, so Baake weiter. Die Stiftung Klimaneutralität hat dazu einen 10-Punkte-Plan erarbeitet. Es gehe dabei vor allem um eine gerechtere Verteilung der Netzkosten zwischen Stromkunden mit und ohne eigener Photovoltaik-Erzeugung durch zeitvariable Netzentgelte. Auch müsse die aktive Steuerung der Anlagen konsequent durchgesetzt werden, um Risiken für die Netzstabilität gar nicht erst entstehen zu lassen und negative Strompreise zulasten des EEG-Kontos zu meiden.
Die Stiftung schlägt vor den im EEG vorgesehenen hälftigen Ausbau der Photovoltaik auf Dächern und Freiflächen zu ändern. Die Zielvorgabe für Freiflächenanlagen sollte von 50 auf 65 Prozent erhöht werden. Mit dieser Änderung sowie einer Fokussierung von Dachanlagen auf neuen Gebäuden und bei ohnehin geplante Sanierungsvorhaben könnten die Erzeugungskosten des Ausbaus um rund ein Viertel gesenkt werden, so die Stiftung. Nach ihren Berechnungen liegen die Investitionskosten für neue Photovoltaik-Freiflächenanlagen bei etwa 450 Euro je Kilowattstunde, während für die Installation von Anlagen auf bestehenden Gebäuden 700 bis 1500 Euro je Kilowattstunde anfielen, also etwa eineinhalb bis dreimal so viel. Mit einem noch höheren Anteil an Freiflächenanlagen ließen sich die Kosten also noch stärker senken. Doch die Stiftung Klimaneutralität empfehle eher einen ausgewogenen Ansatz, der auch Flächenverbrauch, Teilhabe der Bürger und Netzkosten berücksichtige.
Eine Maßnahme, um den stärkeren Freiflächenausbau voranzubringen, wäre das Ausschreibungsvolumen auf 14 Gigawatt jährlich anzugeben. Die Einspeisevergütung für Dachanlagen sollten dagegen kurzfristig auf 10 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden und bis 2030 stufenweise auf 7 Cent pro Kilowattstunde sinken. Allerdings liegt der Tarif aktuell nur für Photovoltaik-Anlagen bis 100 Kilowatt über der Marke von 10 Cent pro Kilowattstunde, wenn sie voll einspeisen. Alle anderen Einspeisevergütungen liegen bereits deutlich darunter und für alle Anlagen ab 40 Kilowatt Leistung auch schon unter der von der Stiftung vorgeschlagenen Grenze von 7 Cent pro Kilowattstunde.
Darüber hinaus empfiehlt die Stiftung Klimaneutralität in ihrem 10-Punkte-Plan, die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie zu nutzen, um Photovoltaik-Anlagen im Neubau und bei Sanierungen zum Standard zu machen. Bis Mai 2026 müsse die Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden. Mit einer allgemeinen Photovoltaik-Pflicht könnten durch eine standardisierte Integration in Planungs- und Bauprozesse die Photovoltaik-Kosten signifikant gesenkt werden, so die Argumentation.
Als weitere Maßnahmen schlägt die Stiftung vor, die Direktvermarktung zu stärken und auch auf kleine Photovoltaik-Anlagen ab zwei Kilowatt Leistung auszuweiten. Die Grenze für die Direktvermarktungspflicht für neue Anlagen kann entsprechend stufenweise bis 2030 gesenkt werden. Die würde zu einem marktdienlicheren Verhalten der Einspeiser führen, also etwa der Abregelung von Anlagen oder Verschiebung der Einspeisung in Zeiten negativer Strompreise. Die Stiftung hält Anreize für Anlagenbetreiber, in die Direktvermarktung zu wechseln für sinnvoll. Ein entsprechender Schritt dazu sei das bereits gesetzlich verabschiedete „Pauschalmodell“ für bestehende Anlagen. Allerdings sind für eine praktische Umsetzung noch Festlegungen der Bundesnetzagentur erforderlich und damit wäre es frühestens ab April 2027 anwendbar. Dieser Prozess müsse beschleunigt werden und eine massentaugliche Umsetzung bereits im April 2026 ermöglicht werden.
Zeitvariable Netzentgelte sollen für alle Stromkunden mit Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen oder Elektrofahrzeugen bis 2028 ganzjährig und verpflichtend eingeführt werden, wie es in einem weiteren Punkt des Plans heißt. Damit könnten gezielt Anreize für einen netzdienlichen Stromverbrauch gesetzt werden. Zudem würden diese zeitvariablen Netzentgelte für Eigenerzeuger in vielen Netzgebieten unerwünschte Verteilungseffekte der Netzkosten zwischen Verbrauchern mit und ohne eigene Photovoltaik-Erzeugung mindern.
Bei den Smart Metern wird ein einklagbarer Rechtsanspruch für alle Netzkunden gefordert samt einer pauschalierten Entschädigungsregelung. Die intelligenten Zähler seien zentral für die Digitalisierung und Flexibilisierung kleiner Stromverbraucher. Ab 2028 sollen die Verteilnetzbetreiber verpflichtet werden, einen jährlichen Nachweis der Steuerfähigkeit von Photovoltaik-Anlagen auf Basis von Echtzeitmonitoring ihres Netzes zu erbringen. Eine Nichterfüllung dieser Verpflichtung müsste automatisch zu entrichtende Strafzahlungen zu Folge haben, so die Stiftung Klimaneutralität.
Bezüglich großer Batteriespeicher wird gefordert, die Anschlussverfahren maximal zu beschleunigen. Dafür sollten die Batteriespeicher aus dem Anwendungsbereich der Kraftwerksnetzanschlussverordnung( KraftNAV) explizit herausgenommen werden. Auch das bisherige „Windhundverfahren“ um die Netzanschlusskapazitäten müsse abgeschafft werden. Die Stiftung fordert vielmehr, ein von Gesetzgeber oder der Bundesnetzagentur entwickeltes, neues regelbasiertes Reservierungsverfahren einzuführen. Damit könnten schnell zu verwirklichende Projekte priorisiert und Anschlusskapazitäten maximal genutzt werden. Kommerziellen Großbatteriespeichern jenseits von Netzengpässen sollte überdies das Laden in Zeiten von Redispatch untersagt werden.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.