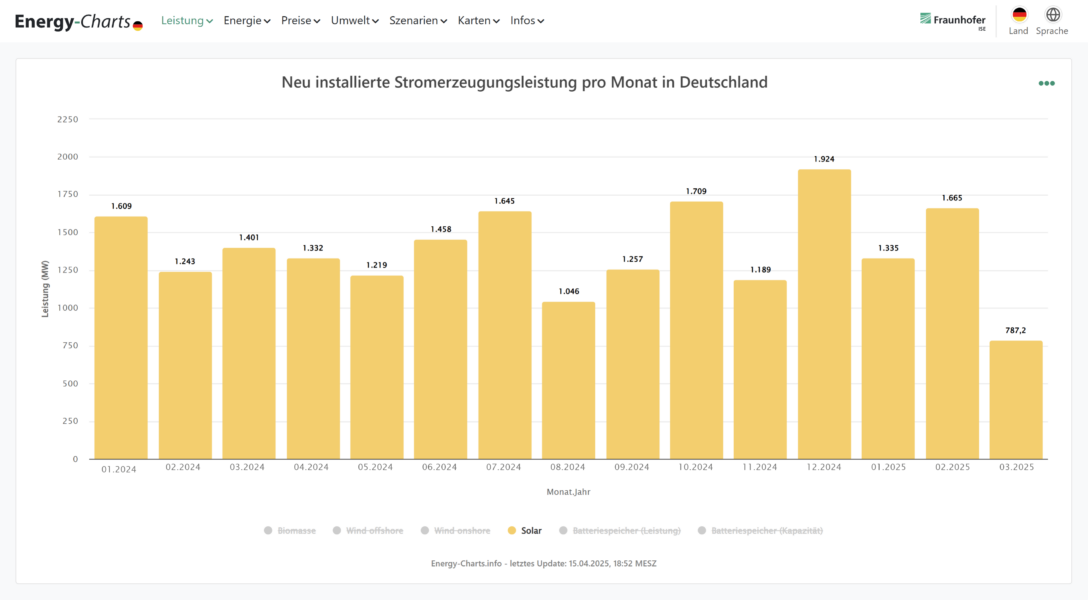Gerade bei Netzstörungen sind die netzbildenden Eigenschaften von Wechselrichtern, sofern sie welche haben, schwer umzusetzen. Ein Team der ETH Zürich entwickelte einen neuen Ansatz, bei dem Frequenz, Spannung und Strom getrennt betrachtet werden. So werden die Frequenzen stabil gehalten und die Geräte gleichzeitig vor Schäden geschützt.
Es gibt einen neuen Algorithmus, um Wechselrichter netzbildend zu betreiben. Der Algorithmus betreibt den Wechselrichter als Spannungsquelle. Das ist wichtig, und zwar, wenn Kurzschlüsse und Spannungsabfälle den Netzbetrieb erheblich erschweren. Der Algorithmus entstand an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich in der Schweiz und wurde bereits zum Patent angemeldet.
Bisher haben Kraftwerke, in denen eine Dampfturbine einen Generator antreiben, die Netzfrequenz vorgegeben und stabil gehalten. Dazu gehören insbesondere Atom-, Kohle- und Gaskraftwerke. Wechselrichter folgten der Netzfrequenz. Da solche Kraftwerke in Zukunft nicht mehr zum Einsatz kommen sollen, braucht es Alternativen. Diese müssen durch neue Fahrweisen von Wechselrichtern an Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher und Windkraftanlagen geschaffen werden.
Solche Wechselrichter müssen Spannungsquelle beziehungsweise taktgebend werden. Doch gerade bei Störfällen ist dieses Verhalten schwer umzusetzen. Bei einem plötzlichen Spannungsabfall im Netz würden die Wechselrichter, sofern sie nicht anders geregelt sind, versuchen, ihr Leistungsniveau zu halten, indem sie entsprechend mehr Strom ins Netz einspeisen. Das würde die Elektronik aber zerstören. Daher schalten die Wechselrichter bei einem Störfall ab, um sich selbst zu schützen.
Ein Team um Florian Dörfler, Professor für komplexe Regelungssysteme an der ETH Zürich, gelang es, einen Algorithmus zu entwerfen, der die Frequenz stabil hält, ohne dass dabei das Gerät Schaden nehmen kann. Dörflers Doktorand Maitraya Desai erkannte, dass bei Netzfehlern die Netzspannung und die Frequenz des Wechselstroms unabhängig voneinander behandelt werden sollten. Die Lösung: Der Regelalgorithmus versucht unter allen Umständen, die Frequenz stabil zu halten. Dabei begrenzt der Algorithmus den Strom und lässt die Spannung frei schwanken.
In einer Computersimulation habe das Team das Prinzip des Algorithmus bereits überprüft. Da es sich bei dem Regelalgorithmus um eine Software handelt, konnte das Team das System auch bereits an einer Testanlage im Labor testen. Der Bau einer neuen Testumgebung war nicht nötig.
Im nächsten Schritt plant Professor Dörfler, dass seine Master-Studenten den Regelalgorithmus gemeinsam mit Unternehmen in der Praxis umsetzen und in neue Produkte einführen.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.