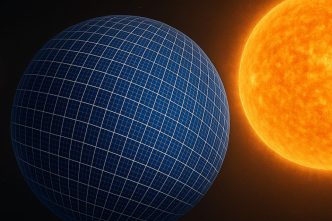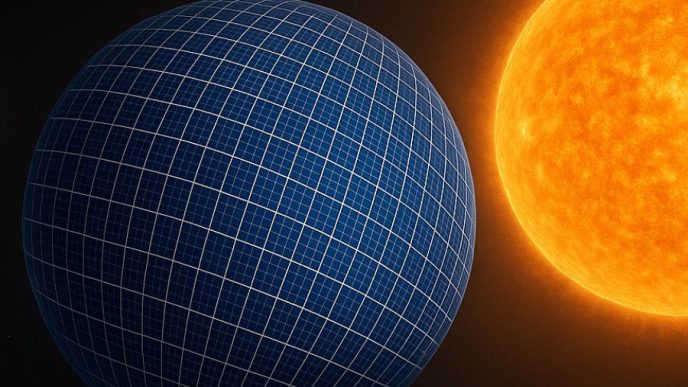Die Bundesnetzagentur hat für die Ermittlung der zusätzlichen Flexibilitäten zwei Szenarien verglichen, wobei in einem der Ausbau von Photovoltaik und Windkraft hinter den Zielen der Regierung für 2030 zurückbleibt. Für das Bundeswirtschaftsministerium ist der Bericht ein weiterer Puzzlestein, um seine ambitionierte Gaskraftwerksstrategie durchzudrücken. Die unzureichende Berücksichtigung der Batteriespeicher in den Szenarien mahnt derweil der bne an.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte verkündet, dass neben dem von ihr beauftragten „Realitätscheck“ auch der Versorgungssicherheitsbericht der Bundesnetzagentur für die weitere Ausgestaltung der Energiewende entscheidend sein wird. Während ihr „Realitätscheck“ noch nicht veröffentlicht ist, legte die Bundesnetzagentur am Mittwoch den Bericht zur Versorgungssicherheit vor, den die Bundesregierung auch direkt im Kabinett beschloss, so das Ministerium. Für Reiche liefert er das gewünschte Futter, um den von ihr geplanten Ausbau von Gaskraftwerken voranzutreiben.
„Wir haben jetzt schon angespannte Netzsituationen an besonderen Tagen und bei besonderen Wetterlagen“, erklärte Reiche zum Bericht. „Das Netz darf nicht auf Kante genäht werden. Der Bericht der Bundesnetzagentur zeigt, dass wir Handlungsbedarf haben und neue steuerbare Kapazitäten, insbesondere neue Gaskraftwerke, zubauen müssen. Bis 2035 sieht der Bericht einen Bedarf im Umfang von 22 bis zu 36 Gigawatt.“
Bedarf an zusätzlichen steuerbaren Kapazitäten
Konkret hat die Bundesnetzagentur den Bedarf an zusätzlichen steuerbaren Kapazitäten berechnet, und zwar für zwei Szenarien. Einmal werden die von der Bundesregierung definierten Ausbauziele für Photovoltaik und Windkraft bis 2030 erreicht; ebenso die angepeilte Erhöhung der Flexibilitäten und der Netzausbau. Dann kommt die Bundesnetzagentur auf einen Bedarf von bis zu 22 Gigawatt an neuen Gaskraftwerken, die bis 2035 errichtet werden müssen, so zumindest die Lesart des Bundeswirtschaftsministeriums.
Im zweiten Szenario wird dagegen eine Verzögerung bei der Energiewende angenommen. Dies betrifft sowohl den Ausbau von Photovoltaik und Windkraft als auch eine eingeschränkte Flexibilität neuer Stromverbraucher. „Solche Verzögerungen würden den Bedarf an steuerbaren Kapazitäten insgesamt erhöhen, auf bis zu 36 Gigawatt Gaskraftwerke bis 2035“, so das Ministerium.
In der Veröffentlichung der Bundesnetzagentur ist derweil nicht so eindeutig, dass die benötigten steuerbaren Kraftwerke alle zwangsläufig Gaskraftwerke sein müssen. „Die Stromversorgung in Deutschland ist gewährleistet, wenn bis 2035 zusätzliche steuerbare Kapazitäten von bis zu 22,4 GW (Zielszenario) bzw. bis zu 35,5 GW (Szenario „Verzögerte Energiewende“) errichtet werden. Dies sind Bruttowerte, die den Zubau ohne Stilllegungen beziffern“, heißt es wörtlich von der Bundesnetzagentur. Der ermittelte Zubau entspreche damit in der Tendenz den Ergebnissen des Monitoringberichts aus dem Jahr 2022, als ein Bedarf zwischen 17 und 21 Gigawatt für das Jahr 2030 ermittelt worden sei.
Allerdings schreibt die Behörde weiter: „Auch könnten Verzögerungen beim Zubau von Erzeugungsanlagen, insbesondere auch der erneuerbaren Erzeugung dazu führen, dass der Strommarkt die Nachfrage nicht vollständig decken kann. Für solche Situationen müssten zusätzliche Reserven außerhalb des Strommarktes für die Versorgungssicherheit eingesetzt werden. Da die Investitionen in steuerbare Kapazitäten bis heute nicht ausreichen, ist es wichtig, den Ausbau zu unterstützen. Die Bundesnetzagentur befürwortet den von der Bundesregierung geplanten gesetzlichen Rahmen für zusätzliche Kraftwerke, die bis 2030 errichtet werden sollen.“
Für Katherina Reiche sicher eine willkommene Vorlage. Sie erklärt weiter: „Der Handlungsbedarf besteht jetzt. Wir müssen deshalb die Kraftwerksstrategie mit Hochdruck vorantreiben und so schnell wie möglich steuerbare Leistung zubauen.“ Dass die Einhaltung der Zubauziele bei Photovoltaik und Windkraft dem gegenüber nicht ganz so dringend ist, lässt sich aus ihrer Äußerung entnehmen: „Gleichzeitig müssen wir beim systemdienlichen Ausbau der erneuerbaren Energien, der Flexibilisierung, dem Speicherausbau sowie dem Netzausbau vorankommen.“ „Systemdienlich“ lässt sich zumindest so interpretieren, dass der Ausbau nicht um jeden Preis erfolgen sollte.
Erschließung von Flexibilitätspotenzialen
Relativ knapp geht die Ministerin dagegen auf einen zweiten wichtigen Aspekt des Versorgungssicherheitsberichts der Bundesnetzagentur ein. „Daneben wird entscheidend sein, dass der Stromverbrauch flexibler auf Strompreise reagiert.“ Die Behörde selbst hingegen sieht in der Erschließung von Flexibilitätspotenzialen bei neuen Verbrauchern ein wichtiges Element. So könnten beispielsweise Wärmepumpen, Speicher, Elektroautos oder Elektrolyseure und Power-to-Gas-Anlagen sowie die industrielle Lastflexibilität einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. „Es müssen die notwendigen infrastrukturellen und marktlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um das Flexibilisierungspotential dieser Verbraucher zu heben. Die Installation geeigneter Messsysteme ist erforderlich, um diese Flexibilitäten von Haushaltswärmepumpen und Elektrofahrzeugen zu erschließen“, so der Bericht der Bundesnetzagentur.
Die Behörde erwähnt auch explizit die Bedeutung von Speichern. „Speicher werden eine immer wichtigere Funktion einnehmen. Schon heute können sich besonders Batteriespeicher im Strommarkt refinanzieren, wie die aktuelle Ausbaudynamik beweist. In bestimmten Marktsituationen können Speicher den Bedarf an zusätzlichen Kraftwerkskapazitäten reduzieren“, so die Bundesnetzagentur. Ein Punkt, den man im Ministerium wohl geflissentlich überlesen hat.
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, fasst die Ergebnisse des Berichts mit folgenden Worten zusammen. „Die Stromversorgung ist auch in Zukunft sicher, wenn zusätzliche steuerbare Kapazitäten errichtet werden. Unser Monitoring unterstreicht die Bedeutung der von der Bundesregierung geplanten Kraftwerksstrategie. Die weiteren notwendigen Kapazitäten sollten über einen Kapazitätsmechanismus bereitgestellt werden. Außerdem ist es wichtig, dass immer mehr Stromverbraucher flexibel auf Strompreise reagieren.“
Damit wird dann ein Kapazitätsmechanismus befürwortet, der eine Refinanzierung der Gaskraftwerke abseits des tatsächlichen Bedarfs sicherstellen würde. Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) dringt in seinem Statement zum Bericht auf schnelle Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke, die aus seiner Sicht zumindest teilweise wasserstofffähig sein sollten. „Hier muss die Politik endlich handeln: Die entsprechenden Ausschreibungen für wasserstofffähige Gaskraftwerke und Gaskraftwerke müssen spätestens bis Anfang 2026 erfolgen, damit die Anlagen rechtzeitig zur Verfügung stehen“, erklärte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. Dafür seien „nur wenige, aber wichtige Anpassungen“ beim Kraftwerkssicherheitsgesetzentwurf erforderlich. Andreae bezeichnete Gaskraftwerke, die in Zukunft auch klimaneutral betrieben werden könnten, als Grundlage für den Kohleausstieg. „Gleichzeitig müssen wir die Entwicklung und Einbindung von Flexibilitäten systemisch und verstärkt angehen“, so die BDEW-Hauptgeschäftsführerin.
Der Verband wirbt eher für einen „technologieoffenen Kapazitätsmarkt“. Damit würde der Bau weiterer Kapazitäten, inklusive Flexibilitäten und Speichern, angereizt. Zudem ließen sich bestehende Biogasanlagen, KWK-Anlagen und Wasserkraftwerken berücksichtigen. Dazu habe der BDEW mit dem Integrierten Kapazitätsmarkt (IKM) einen Vorschlag erarbeitet. „Um das beste Tempo zu erreichen, sollte nun mit dem schnellen Zubau von Kraftwerken und der von Brüssel zu genehmigende Menge begonnen und die verbleibende Lücke an Gigawatt über den Kapazitätsmarkt abgebildet werden“, sagte Andreae.
bne bemängelt unzureichende Berücksichtigung von Speichern
Dass man den Bericht auch anders lesen kann, zeigt das Statement vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne). Nach seiner Interpretation sieht die Bundesnetzagentur für das Szenario „Energiewende“ wenig Probleme. „Damit ist klar, was das vorrangige Ziel der nächsten Jahre sein muss: Volle Pulle Energiewende schon allein aus Sicherheitsgründen“ sagt bne-Geschäftsführer Robert Busch. Für das Szenario „Verzögerte Energiewende“ komme die Bundesnetzagentur zum Schluss, dass 2030 während einiger Stunden des Jahres „eine rein marktliche Versorgungssicherheit nicht gewährleistet“ und der Strombedarf nicht vollständig gedeckt sei. „Für diese wenigen Stunden benötigen wir Speicher und andere Flexibilitäten, welche die Residuallastspitzen reduzieren“, so Busch weiter. „Bei der Bewertung des Berichts muss gleichzeitig berücksichtigt werden, dass er in Teilen schon wieder historisch ist, weil nach eigenem Bekunden der massive Aufwuchs der Speicher nicht ausreichend in die Modelle eingeflossen ist“. Der Bericht lasse daher nur beschränkte Aussagen hinsichtlich Versorgungssicherheitsrisiken zu, so der bne.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.