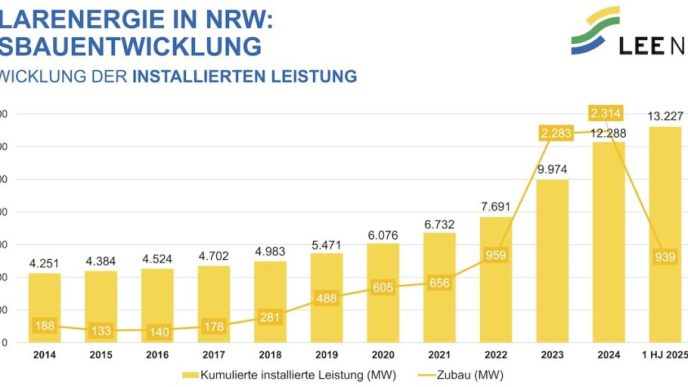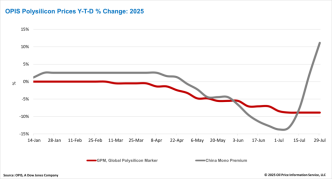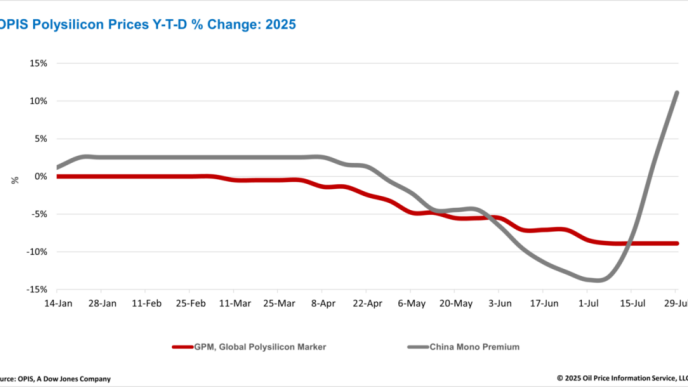Die RWTH Aachen und The Mobility House haben nur „vernachlässigbare Auswirkungen“ durch das bidirektionale Laden von Elektroautos ermittelt, der Mehrwert ist demnach deutlich größer. Intelligentes Laden mit vielen, aber flachen Ladezyklen wirkt sich positiv auf Batteriealterung und Reichweite aus.
Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) und das Elektromobilitäts- und Energiemarktunternehmen The Mobility House haben in einer gemeinsam durchgeführten Studie die langfristigen Auswirkungen von Ladevorgängen auf die Batterien von Elektroautos untersucht. Im Fokus standen dabei Ladestrategien zur Nutzung der Batterien als Flexibilität durch intelligentes, an die Erfordernisse im Stromnetz angepasstes Laden (V1G) oder durch bidirektionales Laden (Vehicle to Grid, V2G), bei dem auch Strom aus der Batterie ins Netz abgegeben wird.
V1G- und V2G-Szenarien wurden dabei mit „Immediate Charging“ verglichen, also dem sofortigen Starten des Ladevorgangs, sobald das Auto an eine Ladestation angeschlossen wird. Es wurden einer Mitteilung von The Mobility House zufolge verschiedene im Markt verfügbare Zelltypen untersucht.
Die Studie sollte auch der verbreiteten Sorge nachgehen, dass viele Ladezyklen die Batterielebensdauer reduzieren, heißt es in einer Mitteilung von The Mobility House. Dirk Uwe Sauer, Professor für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik (ISEA, RWTH Aachen University und Helmholtz-Institut Münster), weist hierbei auf bereits mehrfach untersuchte Zusammenhänge hin. Die häufige Sorge um Schädigungen der Batterie könne „aus dem Weg geräumt werden, wenn ein intelligentes Management eingesetzt wird.“
Entscheidend sei „das Verständnis von Batteriealterung“, heißt es in der Mitteilung: „Das unmittelbare Laden führt zu hoher Alterung, da die Batterie häufig im 100 Prozent-Bereich ist“. Auch für das Stromnetz sei dies eine belastende Strategie, und außerdem werde die Batterie nicht monetarisiert, also kein weiterer wirtschaftlicher Nutzen für den Autobesitzer erzielt. Sofortiges Laden sei deshalb die schlechteste Option.
V1G hingegen erhöht die Lebensdauer. Die Untersuchung ergab, dass nach zehn Jahren die Alterung durch diese Ladestrategie gegenüber sofortigem Laden um 3,3 bis 6,8 Prozentpunkte reduziert wurde, was den Angaben zufolge einem Kapazitätsgewinn von 1,8 bis 3,6 Kilowattstunden oder 10,9 bis 22,5 Kilometer höherer Reichweite (nach WLTP2) entspricht. Die mit intelligentem Laden „unter Berücksichtigung des aktuellen Energiemarkts“ erzielbaren Erlöse werden mit 200 bis 400 Euro jährlich angegeben.
Vehicle to Grid hingegen führt der Studie zufolge nach zehn Jahren zu einer zusätzlichen Alterung zwischen 1,7 und 5,8 Prozentpunkten, entsprechend einem Kapazitätsverlust von 0,9 bis 3,1 Kilowattstunden oder 5,8 bis 19,2 Kilometern Reichweite. Die so verlorene Kapazität jedoch sei zu heutigen Preisen mit einer Investition in die Batterie von 100 bis 300 Euro auszugleichen, gleichzeitig ließen sich aber durch die Vermarktung einer für V2G genutzten Batterie Einnahmen von bis zu 600 Euro jährlich erzielen. Simuliert wurde dies für eine Batterie mit 52 Kilowattstunden, die mit V2G einen zusätzlichen Energiedurchsatz von jährlich 4,7 Megawattstunden erfuhr.
Thomas Raffeiner, Gründer und CEO von The Mobility House, sieht damit eine erneute Bestätigung „für unser Geschäftsmodell und unsere Vision von zero zero – zero Emissionen zu zero Kosten“. Wichtig sei es jetzt, „die regulatorischen Weichen zu stellen, damit wir insbesondere in Deutschland den größtmöglichen Nutzen herausholen können – sowohl für die Elektroautofahrenden als auch für ein erneuerbares Energiesystem.“
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.