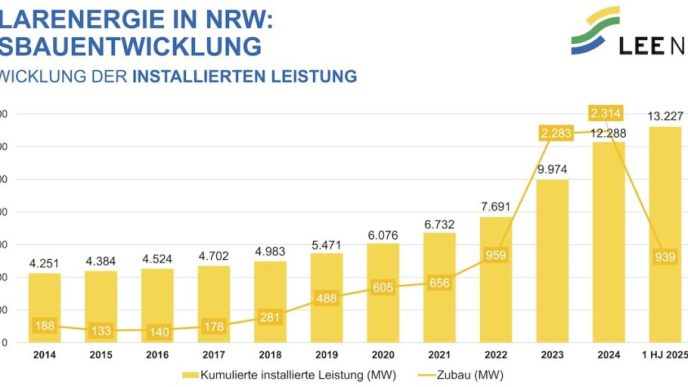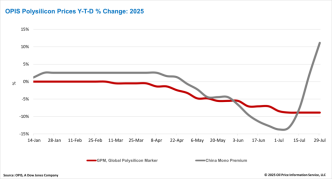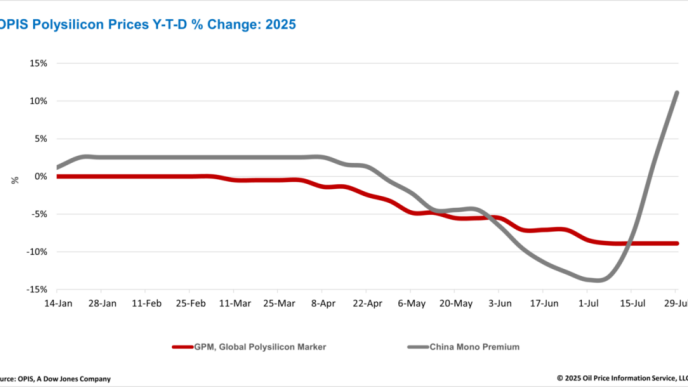Die am Fraunhofer IFAM entwickelte Methode liefert mit „dynamischer Impedanzspektroskopie“ im laufenden Betrieb Daten unter anderem zum Sicherheitszustand. Dies soll optimiertes Batteriemanagement in Elektroautos ermöglichen, ist aber auch für Einsatzbereiche wie Photovoltaik-Speichersysteme gedacht.
Impedanzmessungen liefern Aufschluss über Kapazität und Zustand von Batterien, sind aber bislang nur im Ruhezustand möglich. Wegen der aufwendigen Messungen und Analyseverfahren kann es bis zu 20 Minuten dauern, bis Daten zur Charakterisierung einer Batterie vorliegen. So beschreibt das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM die Motivation zur Entwicklung eines schnelleren und flexibleren Verfahrens, das am Institut entwickelt wurde und Daten in Echtzeit liefern soll.
Die Impedanz einer Batterie kann nicht direkt gemessen werden, sondern wird aus dem Verhältnis von Strom und Spannung errechnet. Mit dem Resultat kann der Ladestand (SOC, State of Charge) der Batterie ermittelt werden und es lassen sich „Rückschlüsse auf den Zustand des Innenlebens mit Kathoden, Anoden oder Elektrolyten (SoH, State of Health) oder den Sicherheitszustand“ ziehen, heißt es in der Mitteilung. Impedanzspektroskopie sei nicht nur für Lithium-Ionen-Batterien geeignet, sondern auch „für Batterietypen auf Feststoff-, Natrium-Ionen- oder Lithium-Schwefel-Basis oder weitere zukünftige Technologien“.
Eine IFAM-Forschungsgruppe unter Leitung von Fabio La Mantia hat das Verfahren nun zur „dynamischen Impedanzspektroskopie“ weiterentwickelt. Damit sei es „erstmals möglich, Messwerte zum Status der Batterie während des laufenden Betriebs zu ermitteln und in Echtzeit verfügbar zu machen“. Es lassen sich also kontinuierlich Informationen gewinnen, die nicht nur Ladekapazität oder verbleibende Betriebsdauer einer Batterie umfassen, sondern auch „ein präzises, tiefgehendes und differenziertes Bild des Innenlebens“ zeichnen. Damit könne auch die mögliche Lebensdauer einer Batteriezelle individuell prognostiziert werden.
Im Vergleich zu bestehenden Ladestandanzeigen, wie sie etwa in Elektroautos integriert sind, biete das Verfahren umfangreichere und präzisere Daten sowie kürzere Reaktionszeiten. Es eröffnet somit „neue Möglichkeiten bei der Optimierung des Batteriemanagements und verlängert damit die Lebensdauer der Batterien“, erklärt Projektleiter Hermann Pleteit.
Das Verfahren arbeitet mit einem dem Entlade- oder dem Ladestrom überlagerten Mehrfrequenz-Prüfsignal. Die unterschiedlichen Frequenzen erlauben den Angaben zufolge Rückschlüsse auf den Status bestimmter Komponenten oder Prozesse in der Batterie. Bis zu eine Million Mal pro Sekunde werde hierfür das Antwortsignal von Strom und Spannung gemessen und simultan verarbeitet. Eigens entwickelte Algorithmen reduzieren die hierbei entstehende, gigantische Datenmenge, damit eine Software in Echtzeit die Impedanzwerte errechnen und Rückschlüsse zum Zustand der jeweiligen Batteriezelle ziehen kann.
Das Verfahren ermöglicht es dem IFAM zufolge beispielsweise dem Batteriemanagement in einem Elektroauto, überhitzte Batteriezellen schnell zu erkennen und abzuschalten. An Ladestationen könne auch bei schnellem Laden dafür gesorgt werden, dass in keiner Zelle gefährliche Temperaturen entstehen.
Die Entwickler sehen Anwendungsmöglichkeiten aber auch bei Batteriespeichern in Kombination mit Erneuerbare-Energien-Anlagen. Anwender erhielten „mit der Fraunhofer-Technik stabile und jederzeit kontrollierbare Batteriesysteme“. Auch in „sicherheitskritischen Szenarien“, etwa in Elektroflugzeugen, sieht das IFAM Bedarf.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.