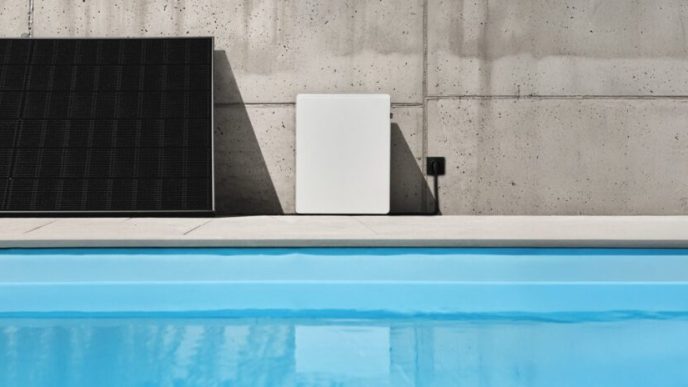Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (EEGe) wurden mit der europäischen Richtlinie (EU) 2018/2001 (RED II) zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien eingeführt. EEGe sollen nicht vorrangig auf finanziellen Gewinn ausgerichtet sein, sondern ihren Mitgliedern „ökologische, wirtschaftliche und sozialgemeinschaftliche Vorteile […] bringen“ (Art. 2, Nr. 16). Außerdem sollen diese Gemeinschaften auch einkommensschwachen und bedürftigen Haushalten offenstehen (Art. 22).
Bei den EEGe geht es neben der Unterstützung der lokalen Energiewende zentral um die Eigenversorgung ihrer Mitglieder mit dem Strom zum Beispiel aus Photovoltaik-Anlagen der Gemeinschaft. Dieses Modell existiert bislang in Deutschland nicht. Allerdings hat das Bundeswirtschaftsministerium am 10. Juli einen Gesetzentwurf zur Novellierung des Energierechts vorgelegt, der unter anderem die „Gemeinsame Nutzung elektrischer Energie aus Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien“, gemeinhin als Energy Sharing bezeichnet, ermöglichen soll. Mit diesem Paragraf 42c werden im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) weitreichende Möglichkeiten des Energieteilens eingeführt.
Wie EEGeim Sommer helfen können
Grundsätzlich kann das Teilen von erneuerbarem Strom innerhalb einer EEGe auf den unteren Spannungsebenen zu einer netzfreundlichen Betriebsweise beitragen. Denn vor allem im Sommer, wenn viel Strom aus kleinen Photovoltaik-Anlagen unter 100 Kilowatt Leistung erzeugt wird, stellt deren ungeregelte Einspeisung viele Netzbetreiber vor Herausforderungen. Solche Anlagen reagieren nicht auf Preissignale und müssen ihren Strom auch nicht selbst vermarkten. Sie erhalten immer ihre garantierte Einspeisevergütung, selbst bei negativen Börsenpreisen. Damit haben sie keinen Anreiz, ihre Stromerzeugung mit dem (lokalen) Verbrauch zur Deckung zu bringen. Das könnte sich durch die Einführung von EEGe ändern.
Zahlreiche aktuellen Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die Einführung von EEGe-spezifischen Tarifen für den selbst erzeugten Strom in Verbindung mit dynamischen Tarifen und Netzentgelten die Stromnetze im Vergleich zur ungeregelten Einspeisung entlastet werden könnten. Dabei kommt es darauf an, in welchem Ausmaß die jeweiligen lokalen Flexibilitätsoptionen wie zum Beispiel das Laden des Elektroautos oder der Betrieb einer Wärmepumpe im Zusammenspiel mit Stromspeichern erschlossen werden können.
Was EEGe Kommunen und öffentlichen Einrichtungen bringen
Neben Privatpersonen können sich künftig auch Kommunen, Gebietskörperschaften und deren privatrechtlich organisierte Gesellschaften an EEGe beteiligen. Dann dürfen sie den günstigen Strom aus eigenen Photovoltaik-Anlagen unter ihren Liegenschaften teilen. Der Bauhof mit Photovoltaik-Anlage kann so zum Beispiel das Freibad im Sommer mit seinem Überschussstrom versorgen. Dadurch können Gemeinden und Gemeindeeinrichtungen ihre Strombezugskosten senken. Mit der Öffnung der Energiegemeinschaften auch für Privatpersonen sowie kleine und mittelständische Unternehmen tragen sie gleichzeitig zur Steigerung der Akzeptanz der Energiewende bei.
Auch öffentliche Wohnungsbaugesellschaften können EEGe gründen oder sich diesen anschließen. So können sie ihren Mieterinnen und Mietern günstigen Strom aus Anlagen der Gemeinschaft liefern. Der Anschluss an eine EEGe kann dabei unter Umständen einfacher als die Umsetzung eines eigenen Mieterstromprojekts sein.
Instrumente für mehr Flexibilität beim Stromverbrauch
Dazu müssen jedoch Flexibilitäten auf der Verbraucherseite erschlossen werden, wozu sich zum Beispiel dynamische Tarifmodelle eignen. Seit April 2025 müssen alle Stromlieferanten ihrer Kundschaft solche Tarife anbieten. Diese sollen Verbraucher dazu anregen, Strom zu verbrauchen, wenn er günstig ist. Das ist meist der Fall, wenn viele erneuerbare Energien an der Strombörse gehandelt werden. Solche Tarife erschließen jedoch keine lokalen Flexibilitäten in Verbindung mit der Erzeugung aus erneuerbaren Energien und der Netzsituation vor Ort.
In neueren Untersuchungen wurden bereits die Wirkungen von dynamischen, auch lokalen Tarifen und Netzentgelten, vor allem auf die Verteilnetze, untersucht. Alle Instrumente zur Steuerung von Stromerzeugung und -verbrauch zeigten, dass diese bei richtiger Ausgestaltung zur Vermeidung von Lastspitzen im Netz und zu einer Verbrauchsglättung beitragen konnten. Im Vergleich zur individuellen Optimierung war dieser Effekt deutlicher im Rahmen von EEGe ausgeprägt, die die Flexibilitätsoptionen der Gesamtheit ihrer Mitglieder erschließen konnten.
Im Ergebnis lassen sich die folgenden Hinweise für die Ausgestaltung eines regulatorischen Rahmens für EEGe in Deutschland ableiten.
- EEGe, deren Mitglieder unterschiedliche Lastprofile aufweisen, können einen höheren Eigenversorgungsgrad erreichen und Lastspitzen weiter reduzieren als EEGe mit sehr ähnlichen Lastprofilen, wie zum Beispiel nur private Haushalte.
- Entsprechend flexible Stromtarife einschließlich flexibler Netzentgelte können Lastspitzen im Verteilnetz reduzieren und zu einem gleichmäßigeren Spannungsprofil beitragen.
- Lokaler Stromhandel unter Nutzung von Flexibilitätsoptionen unterstützt eine effiziente Netzbetriebsführung.
- EEGe als Ganzes können eher Beiträge zu einem netzdienlichen Verhalten auf den unteren Spannungsebenen leisten als Einzeloptimierungen individueller Verbraucher und Prosumer.
- Alle beteiligten Akteure innerhalb einer EEGe, von den Mitgliedern über den Netzbetreiber und Reststromlieferanten bis hin zu einem möglichen „Community Manager“, müssen kommunizieren und kooperieren. So kann ein Netzbetrieb erreicht werden, der nachfrageseitige Flexibilität und EE-Erzeugung in hohem Maß zusammenbringt.
- Das Vorhandensein von intelligenten Mess- und Steuerungssystemen ist für ein netzfreundliches Verhalten der EEGe unerlässlich.
Um die Vorteile des gemeinschaftlichen Stromteilens zu erschließen, bedarf es eines regulatorischen Rahmens, der dieses aktiv unterstützt. Entsprechende Regelungen und Vereinfachungen sind nun mit dem oben genannten Entwurf zur Novellierung des Energiewirtschaftsrechts in greifbare Nähe gerückt.
Konsequenterweise müssen dann auch Netzbetreiber verpflichtet werden, bei ihrer Kundschaft, die sich einer EEGe anschließen möchte, vorrangig intelligente Messsysteme zu installieren und den EEGe-Managern Daten aus diesen zwecks Abrechnung zur Verfügung zu stellen. Dieser Vorrang sollte gesetzlich ebenso festgeschrieben werden, wie dies jetzt bereits im Messstellenbetriebsgesetz bei einem Verbrauch von über 6000 Kilowattstunden Strom pro Jahr und/oder bei Vorhandensein bestimmter Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen der Fall ist.
Damit EEGe perspektivisch zur Netzentlastung beitragen können, sollten auch lokaler Stromhandel und lokale dynamische Stromtarife ermöglicht werden. Diese können jedoch ihre volle Wirkung nur dann entfalten, wenn die entsprechende technische und IKT-Infrastruktur vorhanden ist. So könnten Anschaffung und Einbau von Mess-, Steuer- und Kommunikationsausstattung für Mitglieder von EEGe finanziell gefördert werden. Aber auch der Einsatz intelligenter Mess- und Regeltechnik in Netzen und Netzbetriebsmitteln im Rahmen einer umfassenden Digitalisierungsstrategie sollte für die Netzbetreiber mittels der Netzentgeltregulierung angereizt werden (s. dazu BET et al., 2025, Gutachten für die dena-Verteilnetzstudie II, Kap. 1.3, 4). Eine flexible Tarifgestaltung einschließlich der Absenkung oder des Erlasses von Netzentgelten auf den innerhalb der EEGe ausgetauschten Strom unter bestimmten Bedingungen kann ein systemdienliches Verhalten zusätzlich befördern.
 — Die Autorin Barbara Dröschel ist Wissenschaftlerin im Arbeitsfeld Energiemärkte der IZES gGmbH. Sie forscht seit vielen Jahren zur Integration von Strom aus erneuerbaren Energien in das Energiesystem. Dieser Artikel basiert auf Erkenntnissen der Studie „Erneuerbare Energie-Gemeinschaften (EEGe) und ihre gelingende Integration in das Stromsystem“. Sie wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Modell zur Umsetzung von Erneuerbaren Energie-Gemeinschaften (EEGe)“ (FKZ 03EI5246A) erstellt (mehr Information zum Projekt und zum aktuellen Stand s. hier: https://ee-gemeinschaften.de/). Es wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) im Förderschwerpunkt „Energiewende und Gesellschaft“ des 7. Energieforschungsprogramms unterstützt. —
— Die Autorin Barbara Dröschel ist Wissenschaftlerin im Arbeitsfeld Energiemärkte der IZES gGmbH. Sie forscht seit vielen Jahren zur Integration von Strom aus erneuerbaren Energien in das Energiesystem. Dieser Artikel basiert auf Erkenntnissen der Studie „Erneuerbare Energie-Gemeinschaften (EEGe) und ihre gelingende Integration in das Stromsystem“. Sie wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Modell zur Umsetzung von Erneuerbaren Energie-Gemeinschaften (EEGe)“ (FKZ 03EI5246A) erstellt (mehr Information zum Projekt und zum aktuellen Stand s. hier: https://ee-gemeinschaften.de/). Es wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) im Förderschwerpunkt „Energiewende und Gesellschaft“ des 7. Energieforschungsprogramms unterstützt. —
Die Blogbeiträge und Kommentare auf www.pv-magazine.de geben nicht zwangsläufig die Meinung und Haltung der Redaktion und der pv magazine group wieder. Unsere Webseite ist eine offene Plattform für den Austausch der Industrie und Politik. Wenn Sie auch in eigenen Beiträgen Kommentare einreichen wollen, schreiben Sie bitte an redaktion@pv-magazine.com.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.