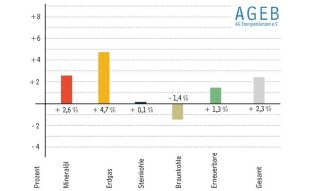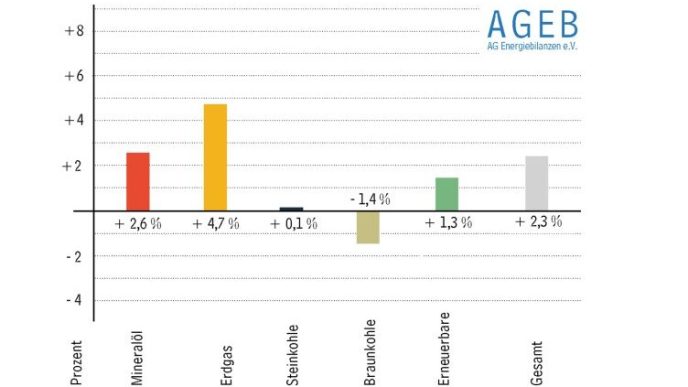Wissenschaftler aus Deutschland und den USA haben untersucht, ob ausgediente Batterien von Elektroautos sofort dem Recycling zugeführt werden sollten. Im Sinne einer möglichst günstigen CO2-Bilanz lautet die Antwort: besser nicht.
Batterien für Elektroautos, die mit einem möglichst hohen Anteil an Recycling-Material hergestellt werden, verursachen weniger Treibhausgas-Emissionen als solche, bei denen die kritischen Rohstoffe vollständig direkt aus der Mine kommen. Das leuchtet unmittelbar ein und ist obendrein auch schon wissenschaftlich untersucht worden. Ebenso einleuchtend und ebenfalls auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass stationäre Batteriespeicher eine günstigere CO2-Bilanz haben, wenn die in ihnen verbauten Batteriezellen zuvor schon in einem Elektroauto eingesetzt worden sind. Einen systematischen Vergleich zur Kombination dieser der beiden Optionen gab es bislang allerdings noch nicht.
Dies hat nun ein Forschungsteam der Universität Münster, der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle (Münster) und des Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley, US-Bundesstaat Kalifornien) durchgeführt. Die Alternative „Recycling oder Lebenszyklus-Verlängerung“ wurde hierfür am Beispiel des US-Bundesstaats Kalifornien untersucht – wobei es indes nicht um ein Entweder/Oder geht, weil nach der Zweitverwendung das Recycling ja immer noch möglich ist. Und dass Batteriezellen, die bereits den Antrieb eines Autos versorgt haben, danach noch gut in einem stationären Speicher Verwendung finden können, ist lange bekannt. In der Gesamtbetrachtung ist aber auch die Frage der Stoffströme wichtig, konkret: Bleibt genug Recycling-Material für die Autoindustrie übrig, wenn Batterien zunächst noch einmal in stationären Speichern genutzt werden.
Bei seinen Berechnungen verglich das Team auf Basis verschiedener Parameter wie Emissionen, Effizienz von Recyclingprozessen, Verkaufszahlen und Lebensdauer von Batterien drei Szenarien. Das „Basisszenario“ beruht auf realen, aktuellen Zahlen: 2,5 Prozent der Altbatterien aus Elektrofahrzeugen werden derzeit als stationäre Energiespeicher weitergenutzt, das Gros wird sofort recycelt. Im „Recycling-Szenario“ wird angenommen, dass sämtliche Altbatterien aus Elektrofahrzeugen ohne vorherige Zweitnutzung ins Recycling gehen. Im „Zweitnutzungs-Szenario“ hingegen werden die Altbatterien für die Zweitnutzung priorisiert, bis der Bedarf für stationäre Speichersysteme vollständig aus dieser Quelle gedeckt ist. Die verbleibenden Altbatterien werden recycelt.
Die Modellrechnungen ergeben ein klares Bild: In Kalifornien ließen sich bis 2050 rund 61 Prozent des Batterie-Bedarfs der Autohersteller decken, wenn alle Altbatterien aus Elektrofahrzeugen ohne Zweitnutzung direkt recycelt würden. Auf diese Weise könnten rund 48 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß vermieden werden. Wird hingegen die Zweitnutzung priorisiert, ließen sich 56 Millionen Tonnen CO2-einsparung erreichen. Dies wäre ohne Versorgungsengpässe möglich, weil die Menge an gebrauchten Elektroauto-Batterien um ein Vielfaches höher liegt als der Bedarf für stationäre Speicher. „Allein die Nutzung aller Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die für den Einsatz in stationären Energiespeichern gut geeignet sind, kann den Bedarf an stationären Energiespeichern bis 2050 decken“, heißt es in einer Mitteilung der Universität Münster. Das bedeutet auch, dass parallel zur Zweitverwendung auch schnell mit dem Aufbau eines Recycling-Systems begonnen werden muss, um all das aufzufangen, was sich nicht in stationären Speichern Verwendung findet.
Das Forschungsteam sieht seine Ergebnisse auch als Beleg für die Notwendigkeit, Lieferketten, Produktion, Recycling und Zweitnutzung im Batteriesektor systematisch zu planen: „Länder, die es schaffen, frühzeitig das gesamte System regional aufzubauen und langfristig die Infrastruktur am zukünftigen Bedarf an Batteriematerialien ausrichten, sind besser positioniert, um die Vorteile der Kreislaufwirtschaft für Elektrofahrzeugbatterien zu realisieren“.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.