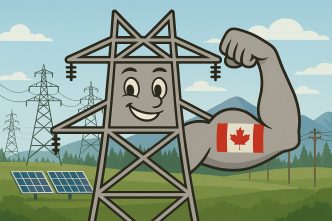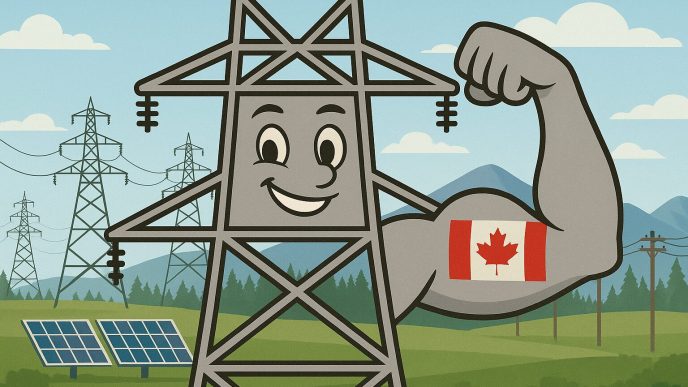Die Karlsruher Richter sehen mit ihrem Urteil die Bundesnetzagentur nicht dazu verpflichtet, Verteilnetzbetreibern die Erhebung von Baukostenzuschüssen nach dem Leistungspreismodell zu untersagen. Vielmehr halten sie Baukostenzuschüsse für Batteriespeicher für berechtigt, wobei sie Ermessensspielraum bei den Verteilnetzbetreibern erkennen. Eine mögliche Abschaffung der Baukostenzuschüsse für Batteriespeicher wertet der BGH dagegen als eine weitere Privilegierung auf Kosten der Letztverbraucher, die die Netzausbaukosten tragen.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Baukostenzuschüsse für Batteriespeicher gebilligt. Dieses Urteil des Kartellsenats zeichnete sich nach der mündlichen Verhandlung vor einigen Wochen bereits ab. Die Bundesnetzagentur sei nicht verpflichtet, den örtlichen Verteilnetzbetreibern die Erhebung eines Baukostenzuschusses nach dem Leistungspreismodell für den Netzanschluss eines Batteriespeichers zu untersagen, so das Urteil der Karlsruher Richter. Sie hoben damit den Beschluss des Beschwerdegerichts auf und wiesen die Beschwerde der Antragstellerin zurück.
Das Beschwerdegericht ist in diesem Fall das Oberlandesgericht Düsseldorf und die Antragstellerin Kyon Energy. Der Projektierer und Betreiber von großen Batteriespeichern hatte im Mai 2021 bei einem Verteilnetzbetreiber ein Netzanschlussbegehren für einen Batteriespeicher mit einer maximalen Lade- und Entladeleistung von 1725 Kilowatt und einer Speicherkapazität von 3450 Kilowattstunden gestellt. Es handelte sich um einen rein netzgekoppelten Stromspeicher, wofür der Verteilnetzbetreiber nach Zuweisung eines Netzverknüpfungspunkts die Zahlung eines Baukostenzuschusses verlangte. Grundlage hierfür war ein entsprechendes Positionspapier der Bundesnetzagentur, die Berechnung des Baukostenzuschusses erfolgte nach dem sogenannten Leistungspreismodell.
Kyon Energy forderte daraufhin die Bundesnetzagentur im Juni 2022 auf, dem Verteilnetzbetreiber gemäß § 31 EnWG die Geltendmachung eines Baukostenzuschusses dem Grunde nach und hilfsweise in der errechneten Höhe zu untersagen. Diesen Antrag wies die Bundesnetzagentur schließlich im Dezember 2022 zurück und es kam zum Prozess, weil Kyon Energy Beschwerde einlegte. Im Dezember 2023 hob das Oberlandesgericht Düsseldorf, vor dem die Beschwerde verhandelt wurde, den Beschluss der Bundesnetzagentur auf. Die Richter werteten den anhand des Leistungspreismodells berechneten Baukostenzuschuss als diskriminierend und als einen Verstoß gegen § 17 Abs. 1 Satz 1 EnWG. Gegen den Beschluss wiederum legte die Bundesnetzagentur Beschwerde ein und somit landete der Fall vor dem Bundesgerichtshof.
Die Richter des BGH kamen nun zu dem Schluss: „Das Beschwerdegericht hat zu Unrecht angenommen, dass die Erhebung eines nach dem Leistungspreismodell ermittelten Baukostenzuschusses für rein netzgekoppelte Batteriespeicher im Sinn des § 17 Abs. 1 Satz 1 EnWG diskriminierend ist.“ Zwar räumten sie in ihrem Urteil ein, dass sich Batteriespeicher von anderen Letztverbrauchern dadurch unterscheiden, dass sie den aus dem Verteilnetz entnommenen Strom nicht verbrauchen, sondern zeitversetzt wieder einspeisen. Der nach dem örtlichen Leistungspreis berechnete Baukostenzuschuss wirke sich daher bei Batteriespeichern stärker standortsteuernd aus als bei anderen Letztverbrauchern. Die Richter erkannten auch an, dass Batteriespeicher eine netzdienliche Wirkung haben können, weil sie bei drohenden Netzengpässen bedarfsgerecht Strom speichern oder ins Netz einspeisen können. „Die Gleichbehandlung von netzgekoppelten Batteriespeichern und anderen Letztverbrauchern ist jedoch nach dem Sinn und Zweck des Baukostenzuschusses gleichwohl objektiv gerechtfertigt“, so das BGH-Urteil weiter. Der Verteilnetzbetreiber habe somit einen gewissen Entscheidungsspielraum bei der Erhebung der Baukostenzuschüsse. „Entscheidet er sich, Baukostenzuschüsse nach Maßgabe des Positionspapiers 2009 der Bundesnetzagentur zu verlangen, kommt es darauf an, ob die Vorgaben der Bundesnetzagentur ihrerseits mit dem Diskriminierungsverbot des § 17 Abs. 1 EnWG in Einklang stehen“, so die Karlsruher Richter weiter.
Sie urteilten, dass die Bundesnetzagentur davon ausgehen durfte, dass die Erhebung des Baukostenzuschusses nach dem Leistungspreismodell trotz der festgestellten Unterschiede zwischen Batteriespeichern und anderen Letztverbrauchern in einem angemessenen Verhältnis zu den damit verfolgten Zielen stehe. Der Baukostenzuschuss nach dem Leistungspreismodell erfüllt nach Ansicht der BGH-Richter eine Lenkungs- und Steuerungsfunktion, weil der Anschluss umso teurer wird, je höher der Leistungsbedarf ist. Damit führt er dazu, den Antragssteller dazu anzuhalten, einen Netzanschluss für seinen tatsächlichen Leistungsbedarf zu beantragen, um eine Überdimensionierung des Verteilnetzes und damit einhergehende Netzausbaukosten, die alle Netznutzer tragen müssen, zu vermeiden. Der Baukostenzuschuss solle überdies zur Finanzierung des Verteilnetzes beitragen. „Beides gilt auch für netzgekoppelte Batteriespeicher, soweit sie das Netz durch Entnahmen nutzen“, urteilte der BGH. „Der Netzanschluss ist wie bei anderen Letztverbrauchern der angefragten Entnahmekapazität entsprechend zu dimensionieren; die Einspeisefunktion hat darauf keinen Einfluss.“
Die Richter betonten ferner, dass die Ansiedlung eines Batteriespeichers, der das Gesamtnetz entlasten könnte, nicht unbedingt förderlich für das lokale Netz sein muss, an dem er angeschlossen wird und für das der Baukostenzuschuss erhoben wird. Dass Kyon Energy bereit gewesen sei, mit dem Batteriespeicher netzentlastende Maßnahmen zu ergreifen, sei für den Baukostenzuschuss nicht maßgeblich. „Nur der Netzbetreiber kann beurteilen, ob und unter welchen Voraussetzungen der netzdienliche Betrieb von Batteriespeichern im örtlichen Verteilernetz zur Verhinderung von Netzausbaumaßnahmen führen kann“, so die Karlsruher Richter. „Es unterliegt daher seinem Entscheidungsspielraum, ob bei der Erhebung von Baukostenzuschüssen transparente und diskriminierungsfreie, mithin notwendig für alle Netzanschlusspetenten geltende, generalisierende Anreize für die Ansiedlung von Batteriespeichern gesetzt werden sollen.“
Der BGH teilte nicht die Ansicht des OLG Düsseldorf, dass sich die Unzulässigkeit des Baukostenzuschusses für Batteriespeicher aus einer Gesamtbetrachtung unionsrechtlicher Vorschriften im Zusammenhang mit der Energiespeicherung ergibt. Zwar seien in der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (EU) 2019/944 und in der Elektrizitätsbinnenmarktverordnung (EU) 2019/943 vom 5. Juni 2019 verschiedene Regelungen zur Energiespeicherung enthalten, die den Anschluss neuer Energiespeicher erleichtern sollen. „Dabei handelt es sich aber um allgemeine Zielbestimmungen, die einen Umsetzungsspielraum belassen und in einem Spannungsverhältnis mit anderen Zielen stehen, wie etwa dem Ziel, Haushaltskunden mit den Kosten für die Stromversorgung nicht unverhältnismäßig zu belasten“, heißt es im Urteil des BGH. Es lasse sich nicht unmittelbar aus den Vorschriften des Unionsrechts ableiten, dass für den Netzanschluss von Batteriespeichern keine Baukostenzuschüsse erhoben werden dürften.
Die Karlsruher Richter verwiesen vielmehr darauf, dass Batteriespeicher durch die aktuell geltende Freistellung von Netzentgelten sowie steuerlicher Vergünstigungen bereits „in vielfacher Hinsicht“ vom Gesetzgeber privilegiert und gefördert werden. Wenn sie nun auch noch von Baukostenzuschüssen befreit würden oder diese geringer ausfielen, müssten die Anschlusskosten auf die Netzentgelte umgelegt und damit von der Gemeinschaft der Letztverbraucher getragen werden. Währenddessen käme die wirtschaftliche Nutzung der Speicher, etwa durch Ausnutzung der Preisschwankungen auf den Spotmärkten, allein dem Betreiber der Speicheranlage zugute, so die BGH-Richter.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.